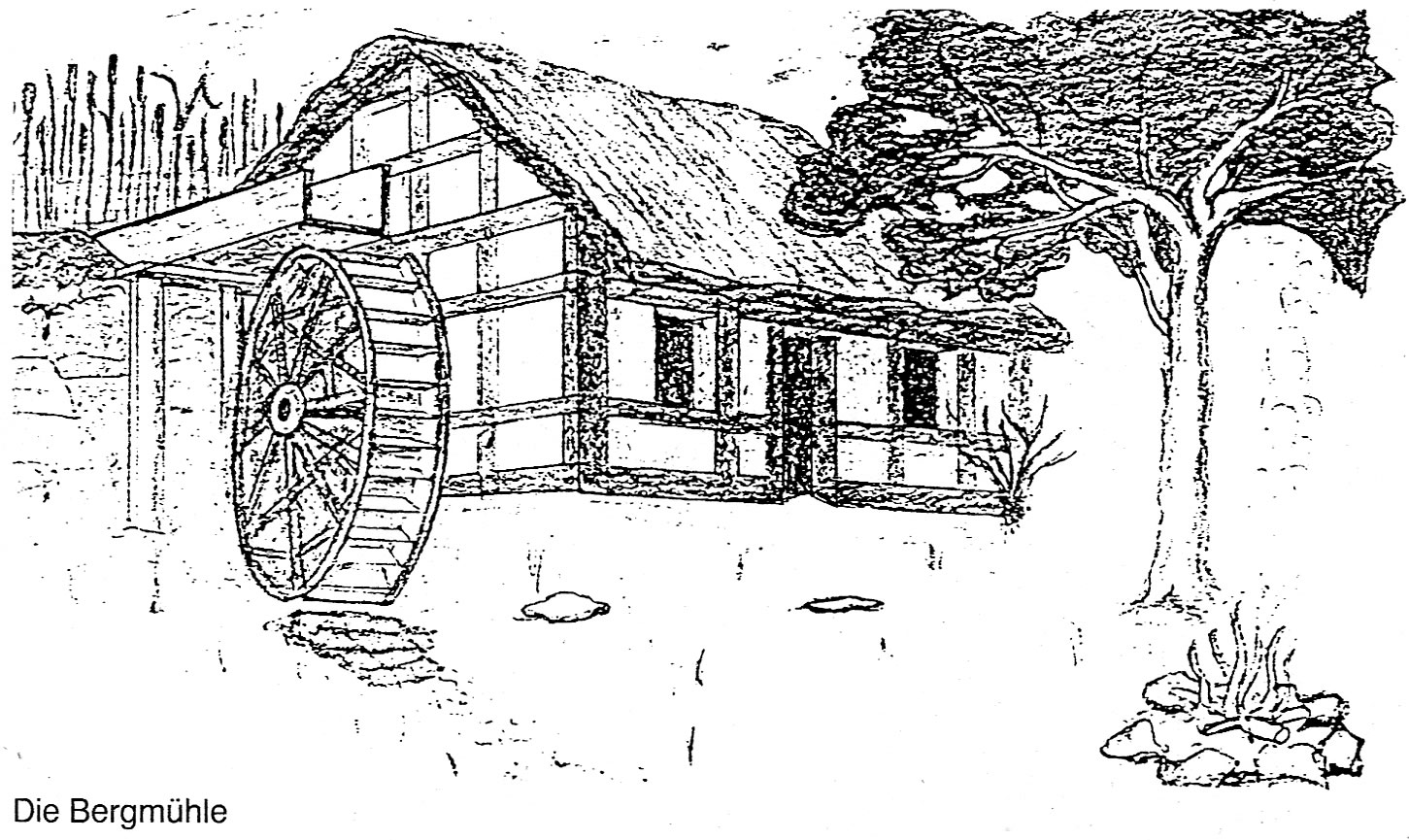Neuer Glogauer Anzeiger, Nummer 8, August 2017
Der Bergmühlbach
von Hans-Jürgen Lau-Henze
1. Fortsetzung aus NGA 8/17
Unter dem dichten Blätterdach der Erlen und Eschen am Waldrand setzte der Bach seinen Weg fort. Er hatte es nicht eilig, denn das Gefälle war nur gering. Ein paar Steine, freigespülte Wurzeln und herabgefallene Zweige ließen nur ein leises Murmeln vernehmen. Nach wenigen hundert Metern mündete der Wasserlauf in einen zweiten Teich, den Bergmühlteich. Auch ihn kannte ich nur als ein in Verlandung begriffenes Schilfdickicht mit sehr niedrigem Wasserstand. Ein am Ablauf zur Regulierung des Wasserstandes eingebautes Trichtersystem ließ auf eine frühere Nutzung zur Fischzucht schließen. Das flache, morastige Ufer und der dichte Schilfbestand boten vielen Vögeln ein willkommenes Eldorado. Stockenten und Teichhühner gründelten im Schlamm. Fasanen fanden reiche Nahrung an Wasserkäfern, Wasserschnecken und Wasserläufern im Uferbereich, bei so guter Deckung konnte Raubwild keine Beute machen. Obwohl der Landweg nach Quaritz unmittelbar am Teich vorbei führte, blieb das Gewässer ein verschwiegener Ort, den das Wild gern annahm. Im Herbst fielen hier oft Wildenten in großer Zahl ein. Vom Weg her konnte man nur durch eine schmale Rohrgasse den Wasserspiegel erkennen.
Im weiteren Verlauf bildete der Bach die Grenze zwischen der Weichnitzer und der Schriener Gemarkung. Dies war das einzige Stück, das früher einmal begradigt worden war, um die Wiesen zu beiden Seiten durch schnelleren Wasserablauf vor Versumpfung zu bewahren. Eine Reihe alter Kopfweiden am Bachrand zeigte von weitem die Grenze an. Diese waren bevorzugte Rastplätze für Bussard, Habicht und Milan. Jede Bewegung im Wiesengras erspähten ihre scharfen Augen. Manche Maus, manch Junghase oder Rebhuhnküken wurde hier eine Beute ihrer krallenbewehrten Fänge.
Der Wasserstand im Bach war recht niedrig. Er reichte uns Kindern nur bis zum Wadenansatz. Auch nach mehreren Wochen ohne Regen trocknete der Bach nicht aus. Die Dränagen der anliegenden Wiesen und Felder, die in den Wasserlauf mündeten, sorgten für genügend Nachfluss. Nur während der Schneeschmelze im Frühjahr und bei starken Gewittergüssen füllte sich das Bachbett bis zum Rand, ohne jedoch über die Ufer zu treten. Die Teiche übten dabei als Wasserspeicher zweifellos eine regulierende Wirkung aus.
Am Ende des rund 300 m langen geraden Verlaufs erfuhr der Bach eine Ableitung von seinem naturgegebenen Weg. Sie diente der Speisung des dritten Teiches, des Mittelteiches. In diese etwa 20 m lange Abzweigung hatte unser Vater mehrere quer zur Strömung stehende Holzwände einbauen lassen. Dadurch entstanden Staustufen, in denen das kühle Bachwasser angewärmt wurde und mitgeführte Schwebeteilchen, vor allem nach heftigen Niederschlägen, auf den Grund absinken konnten. Damit wurde einer raschen Verlandung des Teiches vorgebeugt. Diese sinnvolle Anlage erfüllte aber nur dann ihren Zweck, wenn von Zeit zu Zeit der abgesunkene Schlamm aus den Staukammern ausgehoben wurde.
Die nahezu kreisrunde Wasserfläche von etwa 30 m Durchmesser wurde zu drei Vierteln von Wiese umgeben. Erlen, Weidenbüsche und eine mächtige Kastanie säumten das Ufer des Mittelteiches. Von Süden her hatte die Sonne freien Zutritt. Die Wassertiefe betrug durchschnittlich 2 m. Im Gegensatz zu den oberen Teichen gab es hier keinen Bewuchs mit Wasserpflanzen. Durch ein Trichtersystem konnte der Wasserstand jederzeit reguliert werden. Abseits öffentlicher Wege, versteckt durch das baumbestandene Ufer lag der Teich so verborgen, dass ihn nur Weichnitzer und wenige Ortskundige kannten. Hier lernten wir als Kinder schwimmen.
War der Sommer vergangen, dann zog es uns im Winter zum Schlittschuhlaufen auf den zugefrorenen Mittelteich. Die schlesischen Winter bescherten uns regelmäßig im Januar und Februar starken Frost. Sobald die Eisdecke dick genug war, zogen wir mit den Schlittschuhen über der Schulter raus. Die spiegelglatte Fläche bot eine herrliche Eislaufbahn. Wir spielten Fangen, machten Wettläufe und veranstalteten Eishockeyspiele mit einem Stein oder einem Stück Holz als Puck. Am Abend zeugte dann manch blauer Fleck von Stürzen und Zusammenstößen auf dem Eis.
Alljährlich im Oktober bot der Teich durch den Fischfang auch einen wirtschaftlichen Nutzen. Im Abstand einiger Jahre setzte Vater Jungfische ein, die nach zwei Jahren gefangen und verkauft wurden. Spiegel- und Lederkarpfen und Schleien gediehen besonders gut, wenn granuliertes Trockenfutter ausgestreut wurde. Ein Versuch, auch Forellen aufzuziehen, misslang, weil die Karpfen im Schlamm wühlen und das Wasser trüben. Das sagt der Forelle nicht zu.
Nur ein paar Steinwürfe vom Mittelteich entfernt, speiste der Bergmühlbach den Brückteich. Er wurde so genannt, weil sein Abfluss durch die Brücke der Chaussee Weichnitz — Schrien erfolgte. Beide Teiche waren etwa gleich groß und gehörten zum Gut Weichnitz. Schwarzerlen und Weidenbüsche umschlossen fast das ganze Gewässer. Auch hier konnte der Wasserspiegel durch ein Trichtersystem reguliert werden. Unmittelbar an der Straße gelegen hätte der Brückteich sicher passionierte Angler angezogen. Deshalb wurde er nicht zur Fischzucht genutzt. Von ein paar Weißfischen abgesehen, die von Flugwild eingeschleppt wurden, tummelten sich hier aber umso mehr Frösche. Ein dichter Schilfgürtel erlaubte nur von der Wiese her an einer flachen Stelle den Einstieg in Wasser. Vorübergehende verlockte es im Sommer, schnell ein erfrischendes Bad zu nehmen und den Staub der Landstraße abzuspülen. Weichnitzer und Schriener Kinder plantschten gern im flachen Wasser, das noch kein Schwimmen erforderte. Das störte niemanden. Aber die Frösche sprangen mit einem deutlich hörbaren „Blubb" ins Wasser, um den ungebetenen Badegästen zu entgehen.
Im Winter bei starker Kälte versprach der Teich einen praktischen Nutzen. Wenn das Eis ein Dicke von 15—20 cm erreicht hatte, begann das „Eismachen". Mit der Axt wurde ein Loch in die Eisdecke geschlagen, in das dann eine lange Schrotsäge, die an einem Ende mit einem dik-ken Stein beschwert war, hineingelassen wurde. Zwei Männer schnitten damit große Schollen ab, die dann in kleinere Stücke gespalten und mit langen Misthaken aus dem Wasser gefischt wurden. Auf bereitstehenden Kastenwagen brachten Gespanne die kalte Fracht in den Weichnitzer Park. Dort wurden die Eisstücke vom Wagen über eine Rutsche in den Eiskeller befördert. Dieser bestand aus einem in den Boden eingelassenen ausgemauerten Raum, den ein dicker Erdhügel bedeckte. Zwei schwere Holztüren verhinderten das Eindringen warmer Außenluft. Durch diese natürliche Isolierung hielt sich das eingelagerte Eis bis in den Sommer hinein. Diese einfache Methode war nicht nur eine sinnvolle Arbeit in der arbeitsarmen Winterzeit, sondern auch ein billige Form der Kältekonservierung, denn die Natur schuf das Eis kostenlos.
Kehren wir nun nach den mit den Teichen verknüpften Erinnerungen zurück zum Bergmühlbach, ohne den sie ja nicht denkbar waren. Vom Brückteich an schlängelte sich der Bach mit kaum zu erkennbarem Gefälle durch das Wiesental, das die Weichnitzer und Schriener Gemarkung von einander schied. Hier suchte sich das Wasser seinen eigenen Weg und bildete dabei ein aus unzähligen Schleifen bestehendes Mäanderband. Da gab es unterspülte Uferstellen und stark gekrümmte Kurven, die den Bach streckenweise in Gegenrichtung fließen ließen. Dazwischen waren richtige kleine Halbinseln entstanden. Keine Hand hatte je versucht, den Lauf zu begradigen. Dank des langsamen Wasserabflusses zeigten die Wiesen zu beiden Seiten auch in trockenen Jahren einen üppigen Graswuchs. Im zeitigen Frühjahr, wenn das Wiesenschaumkraut blühte, schienen sie von einem milchigen Schleier überzogen zu sein. Bald zeigten sich dann als gelbe Farbtupfer die ersten Blüten des Löwenzahns und des Scharbockskrauts im noch niedrigen Gras. Neben der Straße, wo der Bach sie gerade unterquert hatte, bestand eine Kolonie gold-gelb blühender Sumpfdotterblumen. Ihr weithin leuchtendes Gelb schien den Ort markieren zu wollen, von dem aus der Bach sich seinen eigenen Weg suchte.
Eine lange Kette alter Kopfweiden kennzeichnete den weiteren Verlauf. Die Dicke ihrer Stämme und die Tatsache, dass viele davon hohl waren, ließ auf ihr hohes Alter schließen. Wenn von Zeit zu Zeit die peitschenartigen Austriebe abgeschnitten wurden, wuchsen schnell wieder neue nach. Vorhandene Lücken wurden geschlossen, indem dort Weidenruten in den feuchten Boden gesteckt wurden. Sie schlugen rasch Wurzeln und wuchsen an. Schon nach wenigen Jahren bildeten sie neue Kopfweiden Obwohl viele Wurzeln der alten Bäume vom Wasser unterspült waren, hielten die übrigen die Stämme allen Naturgewalten zum Trotz fest im Erdreich. Manche Weidenstämme drehten sich wie Korkenzieher, andere neigten sich deutlich übers Wasser. Was lag da für uns Kinder näher, als uns gelegentlich am Bach die Zeit zu vertreiben? Die hohlen Bäume boten herrliche Verstecke, die schiefen Weiden verleiteten zum Hinaufklettern. Besonderen Spaß machte es, den Bach in seinen vielen Windungen zu überspringen und regelrechte Hindernisrennen zu veranstalten. Wer dabei die Breite des Wassers unterschätzte und hineintappte, musste sich dann das schadenfrohe Gejohle der anderen gefallen lassen. Im kristallklaren Wasser konnten wir jeden Stein, jede Wurzel, jedes Blatt auf dem Grunde erkennen. Sollten hier denn keine Fische, vielleicht Forellen, zu finden sein? Trotz aufmerksamen Suchens konnte ich keine sehen. Eines Tages aber entdeckte ich einen Krebs, der mit seinen langen Fühlern den Bachgrund abtastete. Er war kaum zu erkennen, weil sein dunkler Panzer sich gar nicht von seiner Umgebung abhob. Ich bückte mich und streckte vorsichtig eine Hand aus, um ihn zu ergreifen. Doch im Augenblick, da ich die Wasseroberfläche berührte, verschwand er blitzschnell. Nur eine trübe Spur im Wasser verriet, in welche Richtung er geflüchtet war. Als sich das Wasser geklärt hatte, war er nicht mehr zu sehen. In einer Unterhöhlung im Ufer musste er sich versteckt haben. Wie konnte sich der recht plump aussehende Geselle so schnell meinem Zugriff entziehen? Diese Frage ließ mir keine Ruhe. Ich studierte daraufhin zu Haus mein Biologiebuch, worin ich eine längere Abhandlung über den Flusskrebs fand. Er gehört zu den Gliederfüßern und ist ein Verwandter seines großen Bruders, des Hummers, der im Salzwasser des Meeres, z. B. bei Helgoland lebt. Wie die Fische atmet er mit Kiemen im Wasser. Da er die Dämmerung und die Nacht liebt, hält er sich tagsüber versteckt im Halbdunkeln zwischen freigespülten Wurzeln und in Aushöhlungen des Ufers auf. Es muss also ein glücklicher Zufall gewesen sein, dass ich einen seiner Artgenossen bei Tageslicht entdeckt hatte. Der harte Rückenpanzer gibt ihm Schutz nach oben und zur Seite, erlaubt ihm aber keine seitliche Krümmung. Seine Augen sitzen an beweglichen Stielen und erlauben ihm einen vollkommenen Rundblick. Daher konnte er meine Hand sehen, als ich sie ihm von hinten näherte. Auf zehn gegliederten Beinen bewegt er sich am Boden kriechend fort. Mit zwei ständig in Bewegung befindlichen langen Fühlern am Kopf untersucht er seine Umgebung. Zwei starke Scheren erlauben ihm, seine Beute, z. B. Würmer, Wasserinsekten und Frösche zu fangen und zu zerkleinern. Den breiten, fächerförmig endenden Schwanz kann er ruckartig nach unten gegen die Bauchseite einschlagen. Das ermöglicht ihm bei Gefahr eine schnelle Rückstoßbewegung.
>Die Bergmühle<
Eines Abends brach ich mit meinem Freund Martin, mit Taschenlampe und Eimer bewaffnet, auf zur Krebsjagd. Im Schein der Lampe suchten wir den Wasserlauf ab, bis wir Krebse fanden. Wir stellten bald fest, dass es viel mehr gab, als wir angenommen hatten. Zwar waren nicht alle ausgewachsen, aber die kleinen ließen auf eine reiche Nachkommenschaft schließen. Vor allem dort, wo die Natur Schlupfwinkel im Ufer geschaffen hatte, fanden wir oft mehrere dicht beieinander. Die plötzliche Helligkeit störte die Tiere nicht. Sie wanderten am Bachgrund weiter oder verharrten dort, wo sie der Lichtstrahl traf.
Um den Krebsen den Fluchtweg nach rückwärts abzuschneiden, schoben wir ihnen die Hand sehr behutsam von hinten entgegen. Nur durch ein blitzartiges Zugreifen am Rückenpanzer gelang es uns dann, sie zu erfassen. Ein Fehlgriff konnte recht schmerzhaft werden, wenn die sägeartig bewehrten Scheren einen Finger erfassten. Er wurde so fest umklammert, dass er durch bloßes Abschütteln nichtfreizubekommen war. Erst nach gewaltsamem öffnen der Schere gelang es dann, den Finger zu befreien. Das ging meistens nicht ohne ein paar Tropfen Blut ab. Wir brachten es mit unserer Fangmethode bald zu einer gewissen Fertigkeit. Nur ausgewachsene Exemplare mit hartem Rückenpanzer und großen Scheren kamen in den wassergefüllten Eimer. Die anderen entließen wir in ihr kühles Element in der Hoffnung, ihnen im nächsten Jahr wieder zu begegnen. Unsere Fänge zählten oft an einem Abend zwei Dutzend Krebse. Wir konnten unsere Beutezüge nur in den Sommermonaten durchführen, wenn der Panzer nach der jährlichen Häutung gehärtet war. Unsere Fundstellen hüteten wir wie ein Staatsgeheimnis, um keine Nachahmer zu bekommen.
Ob es heute noch Krebse im Bergmühlbach gibt, das ist sehr zweifelhaft. Die Krebspest, eine gefährliche Seuche, und die zunehmende Verschmutzung der freien Gewässer haben die Bestände sehr vermindert. Unterhalb unserer Fanggründe schlängelte sich der Bach weiter durch die Gemarkungen der Gemeinden Kladau, Samitz, Schlatzmann und Fröbel. Ob er auch dort von Krebsen besiedelt war, ist mir nicht bekannt. Nach etwa 7 km erreichte er bei Fröbel die Oder.
Wie bereicherte doch der muntere Bergmühlbach unsere kindliche Vorstellungswelt. Vielfältige Erinnerungen an ihn und an seine Teiche haben sich in unser Gedächtnis eingegraben. Wir empfanden den sauberen Bach und seine dicht bewachsenen Ufer als etwas Naturgegebenes in unserer heimischen Landschaft. Umweltschäden durch Wasser- und Luftverschmutzung kannten wir nicht. Der Bach bildete nicht nur die natürliche Grenze zwischen zwei Dörfern, sondern auch einen Lebensraum besonderer Art und voller Geheimnisse. Er öffnete uns die Augen für das Leben der Tiere im Süßwasser und die Schönheit und den Artenreichtum der Pflanzen in seinem Feuchtbereich. Wir erkannten die Wirkung des ständig fließenden Wassers, das an den Ufern nagt und dadurch Heimstätten für mancherlei Tiere schafft.
Mochten wir all das damals mehr oder weniger unbewusst empfunden haben, so knüpfen sich heute noch viele bleibende Eindrücke daran. Voll bewusst waren wir uns aber der Möglichkeiten, die uns der Bach und seine Teiche zu allen Jahreszeiten bei Spiel und Sport boten. Sie regten unsere Phantasie an und reizten uns zu immer neuen Entdeckungen und Abenteuern. Der Bergmühlbach war für uns ein Stück Heimat, das wir spielend, forschend und staunend erlebten.